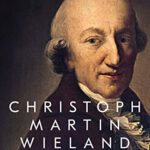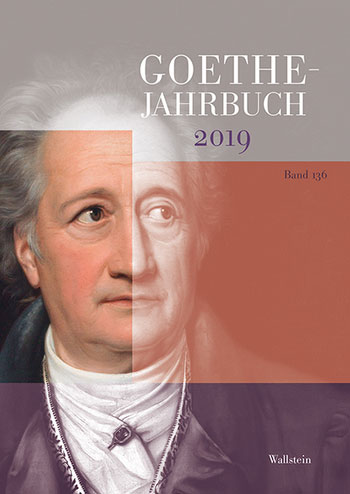Blog
Schillers Krankheiten. Pathographie und Pathopoetik – der Schillerverein Weimar-Jena hat eine neue Schriftenreihe begonnen
Friedrich Schillers Biografie liest sich wie eine Tragödie. Von früh an litt er unter schweren Krankheiten. Als Arzt konnte er nur zu genau beurteilen, wie es um ihn stand. Alt wurde er nicht, hat aber in den wenigen Jahren ein beeindruckendes Œuvre geschaffen. Unter erheblichen Schwierigkeiten rang er sich mit Disziplin und Courage, gegen widrige Umstände auch sozialer und politischer Art, Werke ab, die sich kritisch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzten und ihre Brisanz bis heute bewahrt haben. Schiller wusste angesichts feudaler Macht-Ausübung, der er entflohen war nach Mannheim, warum er „Gedankenfreiheit“ forderte, nach 1933 mochten die Herrschenden diese Forderung auf den Bühnen nicht hören und heute wird bereits der Gebrauch des Begriffs „Krieg“ in Russland strafrechtlich verfolgt.
Als promovierter Mediziner konnte er einschätzen, dass ihn seine literarischen Ambitionen zusätzlich belasten würden. Im Brief an Goethe brachte Schiller seine Lage am 29. 8. 1795 auf diese Formel: „Mit meiner Gesundheit geht es noch nicht viel beßer. Ich fürchte, ich muss die lebhafte Bewegungen büssen, in die mein Poetisieren mich versetzte. Zum Philosophieren ist schon der halbe Mensch genug und die andere Hälfte kann ausruhen; aber die Musen saugen einen aus.“ (S. 11) Auch wenn mancher Philosoph das vielleicht anders sehen mag: Hier bekennt sich ein Dichter ohne Rücksicht auf Verluste an der eigenen Gesundheit zu einer Berufung, die er offenbar als Verpflichtung, als seine ureigenste Aufgabe angesehen hat.
Und ihm war bereits früh schon klar, dass er sich beeilen musste: „Eine große und allgemeine Geistesrevolution werde ich schwerlich Zeit haben, in mir zu vollenden aber ich werde thun was ich kann, und wenn endlich das Gebäude zusammenfällt, so habe ich doch vielleicht das Erhaltenswerthe aus dem Brande geflüchtet.“ (S. 10) Ebenfalls an Goethe in einem Brief vom 31. August 1794. Gut ein Jahrzehnt blieb ihm damals noch für seine Arbeit bis zu seinem Tod am 9. Mai 1805 in Weimar.
Diesem Arbeits-Ethos und seinen gesundheitlichen wie natürlich auch literarischen Dimensionen hat der Schillerverein Weimar-Jena e. V. den ersten Band der neuen „Schiller-Studien“ von 2021 gewidmet: „Schillers Krankheiten. Pathographie und Pathopoetik“, herausgegeben von Helmut Hühn, Nikolaus Immer und Ariane Ludwig.
Schon fast ironisch oder makaber mutet an, dass die Herausgabe dieses schmucken Bandes von 144 Seiten mit 4 farbigen Abbildungen ihrerseits ebenfalls medizinische Ursachen hatte: Konnten doch aufgrund der Covid-Pandemie 2020 die Schillertage nicht stattfinden. Deshalb beschloss der Verein, die bewährten jährlichen Schillerhefte zu bündeln und angesichts der weltweiten Gesundheitskrise Schillers Krankheiten und deren Niederschlag im Werk zum Thema dieses Buchs zu machen.
Besonders interessant ist, wie weit die damals aktuellen medizinischen Erkenntnisse in der Tradition antiker Ärzte wie Hippokrates und Philosophen bis hin zu den Stoikern und Epikureern standen und von Schiller in seine Studien und seine Dissertation aufgenommen wurden, wie weit sich die Medizin entwickelt hat, und wie Schiller diesen damaligen Wissensstand in seine Texte einfließen lässt. Nachdem Schillers erster Versuch einer Promotion im Sande verlief, weil sie 1779 von den Gutachtern als „allzu spekulativ und medizinfern“ (S. 23) abgelehnt wurde, hatte er mit seinem zweiten Anlauf 1780 mehr Erfolg und wurde nach mündlicher Prüfung in Anatomie, Physiologie und Arzneimittel-Geschichte zum Doktor der Medizin promoviert.
Schillers eigene Krankheiten schlagen sich im literarischen Werk nieder und auch die damaligen medizinischen Vorstellungen: „auf der Makroebene der Dramenästhetik“ und „auch auf der Mikroebene des Dramentextes“, etwa wenn Franz von Moor fragt: „Aber ist euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blaß?“ (S. 14) Die Hautfarbe galt bereits Schillers Kollegen als Symptom einer Erkrankung und wird bis heute so bewertet.
Drei Aspekte beleuchten die Aufsätze. Zunächst widmet Peter-André Alt sich dem Phänomen erhöhter Temperatur: „Gestörtes Gleichgewicht. Fieber als Topos und metapoetische Chiffre in Schillers Die Räuber und Don Carlos“ (S. 23–63). Anzeichen von Fieber dienen Schiller dazu, seine Figuren oder deren Verhalten zu charakterisieren: „Karls mehrfach beschworene ‚Hitze‘ passt mithin zu den Pathologien des schwärmerisch-weltflüchtigen Charakters, wie ihn die Literatur der Zeit vor Augen führt.“ (S. 37) Die Hitze der Rebellion führe zu einem „Höllenbrand“, Karl wandele sich zu einem „Satan“, der „teufelsmäßig“ wüte, „wo er Unrecht sühnen will“ (S. 37).
Im „Don Karlos“ setzt Schiller sichtbare Merkmale ein: „Karlos‘ Erhitzung, die sich in den roten Wangen und dem fiebrigen Zittern seiner Lippen manifestiert, ist der Ausdruck seiner erzwungenen Untätigkeit.“ (S. 45) Fieber avanciere, führt Alt in seinem „Fazit“ aus, „zu einer Art Chiffre für bestimmte leib-seelische Verknüpfungen, für zerrüttete Zustände im Affekthaushalt des Menschen: für jene literarische Anthropologie, die der junge Schiller wie kein anderer Autor seiner Zeit auf ein profundes medizinisches Wissen stützt.“ (S. 51)
Ganz aktuell angesichts Corona mutet auch die Diskussion über die Notwendigkeit einer Pockenschutz-Impfung gegen Ende des 18. Jahrhunderts an, die Cornelia Zumbusch in Ihrer Arbeit über „Absolute Immunität. Politische Affekte und ästhetischer Schutz in Schillers Braut von Messina“ (S. 65–106) thematisiert. Immun solle die Kunst sein und sich nicht von „den Pathologien ihrer eigenen Zeit anstecken“ lassen (S. 66). „Nur indem sich der Künstler an den reinen Formen der Antike schule, könne er sich von den Pathologien der eigenen Gegenwart freihalten.“ (S. 67) Gemeint ist mit Immunität einerseits eine freie Kunst, die nicht staatlich verfolgt werden darf, sowie andererseits auch ein „Zustand der inneren Freiheit“ (S. 67) des Künstlers, der sich nicht von aktuell möglichen Verirrungen anstecken lassen solle.
Am Beispiel der „Braut von Messina“ geht es um den Bruderzwist, der in einen Bürgerkrieg auszuarten droht – damals eine aktuelle Gefahr: „So gelesen bringt Schiller in der Braut von Messina in den ersten Auftritten die schreckenerregende Volksmasse auf die Bühne, die mit der Französischen Revolution die Bühne der Geschichte betreten hat.“ (S. 98) Indem Schiller im Theater Gefahren darstellt, will er die Zuschauer dagegen immunisieren: „Autonome als immune und zugleich immunisierende Kunst steht […] im Zeichen einer Prävention, die durch den gezielten Einsatz starker und schmerzhafter Affekte moralisch souveräne Subjekte formieren und auf den Staat der Freiheit vorbereiten soll.“ (S. 99)
Als Dritter im Bunde der Beiträger untersucht Wolfgang Riedel „Wie zu sterben sei. Zur meditatio mortis bei Schiller“ (S. 107–131). Bedeutung, Art und Funktion des Todes in Schillers literarischen und theoretischen Werken nimmt er unter die Lupe und führt seine Überlegungen zu Schillers Darstellung auf antike Vorstellungen zurück. Allerdings sei Schiller auch ganz persönlich mit dem nahen Ende konfrontiert gewesen. Die letzten anderthalb Jahrzehnte seines Lebens, eine „Phase höchster Produktivität“, habe er „an den Folgen wiederkehrend-wandernder, immer weiter ausgreifender eitriger Schwerstentzündungen im Brust- und Bauchraum“ gelitten, die „keinen Zweifel an bestehender Todesgefahr“ (S. 107) zuließen.
Von zentraler Bedeutung für Riedel ist dabei Schillers Abhandlung „Über das Erhabene“, die er 1801 veröffentlichte. Schillers „Ethos der Selbstdistanz (wie relativ sie am Ende auch immer sein mag)“ (S. 111) ziele darauf ab, die eigene Person und Befindlichkeit quasi als Beobachter wahrzunehmen: „Mit uns selbst wie mit Fremdlingen umzugehen“. (S. 112) Schiller verzichte dabei „auf alle christlichen Tröstungen und Hoffnungen“ und: „‚Religionsideen‘, speziell die ‚Idee der Unsterblichkeit‘, kommen in der Theorie des Erhabenen nicht zum Zuge.“ (S. 116)
Abschließend vergleicht Riedel Schillers Überlegungen mit seinen tragischen Helden: „Schillers Tragödien mangelt es nicht an Bühnentoden, aber nicht alle werfen für unsere Fragestellung etwas ab. Das Werk der achtziger Jahre scheidet aus; die Krankheit war noch nicht da, und die Theorie des Erhabenen noch nicht geschrieben.“ (S. 117) Trotzdem lässt er die sterbenden Heroen Revue passieren. Einige Beispiele: „Franz, in höchster Panik und gänzlich unerhaben, ‚reißt seine goldene Hutschnur ab und erdrosselt sich‘. Das ist im Grunde so unmöglich wie sich mit den eigenen Händen zu erwürgen.“ (S. 118) Max Piccolomini ereile leider kein „Heldentod“, er gerate „unter die Hufe der eigenen Reiterei“. (S. 119) Und fasst zusammen: Im Sinne einer „‚erhabenen‘ Konfrontation des Todes“ werde bei Schiller „wenig gestorben“. (S. 120)
Angenehm aus dem Rahmen der übrigen Tode falle lediglich „der sterbende Talbot“, in dem Schiller „wie der Maler auf alten Gemälden […] das einzige Selbstporträt […] in seinen Dramen“ gegeben habe (S. 125). Für einen „literarischen Coup des späten Schiller“ halte er Talbot, sagt Riedel, der „nichts Platonisch-Neuplatonisches und vor allem nichts Christliches zu Wort kommen“ lasse (S. 124). Aus Berichten, Schiller sei am Ende heiter gewesen, schließt Riedel: „Wenn dies so war, starb auch Schiller nicht nur als Stoiker, sondern als Epikureer.“ (S. 125)
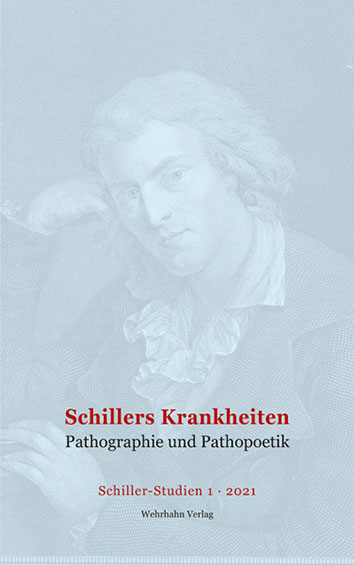
Helmut Hühn, Nikolaus Immer und Ariane Ludwig (Hg.)
Schillers Krankheiten. Pathographie und Pathopoetik
(= Schillerstudien 1/2021 des Schillervereins Weimar-Jena e.V.)
Wehrhahn Verlag, Hannover 2022
144 Seiten mit 4 farbigen Abbildungen
ISBN: 978-3-86525-939-4
Preis: 18,00 €